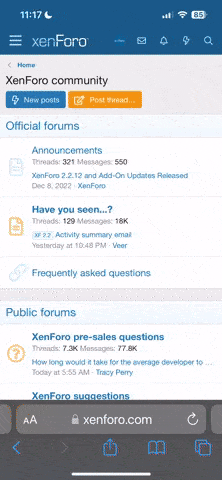- Beiträge
- 3.242
Soweit richtig. Wichtig wäre, sich darüber bewusst zu sein, dass das Vakuum selbst "Nichts" ist und damit auch keine Kräfte ausübt.9 Tonnen pro Quadratmeter klingt gewaltig, bedeutet aber 900 millibar unterdruck
Nicht das Vacuum saugt, sondern der umgebende Luftdruck drückt. Und der drückt (je nach Wetterlage) mit ungefähr maximal 1000 mbar.
Das heißt, ein "Vakuum" von 900 mbar Unterdruck oder 9 Tonnen pro Quadratmeter sind schon 90 % des maximal Erreichbaren von 1000 mbar, d.h. von den maximalen 10 Tonnen pro m2.